
Das kurze Leben des Ray Müller
DVA, München 2015
Um einen Staat zu beurteilen, sagt Tolstoi, muss man seine Gefängnisse von innen sehen. Ralf Bönt war in den letzten Jahren auch auf Friedhöfen, in Krankenhäusern und Arztpraxen. Jetzt geht er in den Geburtsraum und erzählt Das kurze Leben des Ray Müller.
Der Roman ist Sozialstudie, Psycho-Drama, Zeitzeugnis und spannend wie ein Thriller. Marcella Drumm, WDR. * Ein Meisterwerk! Buchhandlung Jacobi & Müller, Halle. * Tatsächlich buchstabiert der Icherzäler am Anfang des Jahrtausends einen neuen Typ Mann aus. Dies ist ein notwendiges Buch. Pascal Fischer, SWR. * Virtuos geschrieben! Katharina Schmitz, Der Freitag. * Ein intensives Buch, das unter die Haut geht. Winfried Stanzick, amazon. * Dass der Konflikt so spannend und lehrreich ist, liegt an Bönts subtiler Sprache. Johannes Balle, Kölner Stadtanzeiger. * Das kurze Leben des Ray Müller erzählt von einer Figur, die es so in der Literatur bisher nicht gab. Bönt gelingt es, Stimmungen in Bilder zu fassen und mit leichter Hand einen neuen Typ Mann zu schaffen. Britta Heidemann, Die Welt. * Das kurze Leben des Ray Müller lässt mich von der ersten Seite an nicht mehr los. Angelika Abels, Buchtipp. * Das kurze Leben des Ray Müller muss man unbedingt lesen. Vielleicht DER Roman über das Mannsein in unserer geschlechtsverwirrten Zeit. Ferdinand Knauß, Facebook. * Am 20. und 27. Mai liest Ralf Bönt im Deutschlandfunk Auszüge aus dem Roman, 2:30 Uhr und 20.30 Uhr, Redaktion Hubert Winkels.
Körper ohne Grenzen
Am Anfang steht eine schwangere Frau einen Tag vor dem Geburtstermin. Ihr Mann bemerkt vor ihr, dass ihr Bauch mal hart und mal weich ist. Sie gehen zum Gynäkologen, der einen leicht geöffneten Muttermund feststellt. Er sagt das in diesem bemächtigendem Ärzteton, in dem der Patient zum Ding wird, vielleicht denkt man an Moliere.
Was als leichter Übergriff eines Gynäkologen beginnt, entwickelt sich in der langen Eingansszene unter der Frage Kaiserschnitt oder Lageänderung zum dramatischen Beweis, wie sehr jeder vom anderen abhängt, beeinflusst und durchdrungen wird. Als das Kind – Ray Müller – nach einer langen, bewegenden und sehr spannenden Geburt endlich sicher und glücklich abgenabelt ist, heißt es, man denke ja selten daran, dass der menschliche Körper vor allem aus Flüssigkeiten bestünde. Eine Geschichte der Verflüssigung jeglicher individueller Souveränität folgt. Sie findet auf allen Ebenen statt, biologisch, sozial, gesellschaftlich, historisch, politisch, familiär. Und sexuell.
Der Icherzähler Marko Kindler leidet an einer Unterfunktion der Schilddrüse und damit der Energieversorgung. Ausgelöst durch Umweltgifte zerlegt sie sein Leben langsam und sicher in seine Einzelteile. Zum Glück ist das in Rückblenden geschildert, die einen notwendigen Abstand herstellen. Statt das übliche, auf Mitleid setzende Gejammer von Krankengeschichten findet man hier und da blitzenden Humor. Im medizinischen Betrieb, der den einzelnen eher als Rohstoff seines Funktionierens denn als Gegenstand seiner Bemühungen sieht, erfährt Kindler eine Entmündigung. So skurrile wie real anmutende Dialoge mit Ärzten und Ärztinnen gehen in perfide Unterstellungen und Missdeutungen seiner ersten Frau über, die mit der komplexen Situation überfordert ist.
Konsequent spiegelt sich diese Geschichte in der New Yorker Freundin Nele Black, die ähnliche Symptome hat. Sie hat auch ein ähnlich distanziertes Verhältnis zu ihrem Körper wie Kindler. Sie wurde, so erfährt man, vom Vater missbraucht. Jeder ist jemandes Kind, denkt man, während die Verunsicherung fortschreitet und man gebannt auf ein wie im Krimi inszeniertes Finale hin liest. So erfährt Kindler, der ein hochproblematisches Verhältnis zu seiner Mutter hat, spät von deren Rolle als Kriegsopfer 1945. Von ihrer Gefühlskälte in die Defensive gedrängt, konnte er der Freundin Nele nicht der benötigte Freund sein. Dazwischen gibt es einen so bissigen wie komischen und manchmal zärtlichen Ausflug in die Welt des kommerziellen Sex, vor dem Hintergund der nicht zueinander kommenden Freunde. Als Kindler am Ende sein Kind entführt, schließt sich der Teufelskreis der Gewalt: Opfer ist immer der schwächste.
Auch historisch und politisch gibt es einen Motivschluß über einen langen Zeitraum. Während Kindlers Unglück vom Ende des Krieges herrührt, gerät Nele Black in die Staubwolke des 11. September, was ihre gesundheitlichen Probleme verschlimmert. Es sei sehr einfach, sagt Kindler anfangs schlaflos in Manhattan, einen Verstand zu rauben. Das gilt auch für ein Leben: Nele stirbt, und zwar so, wie ein Arzt es Kindler für ihn selbst prophezeit hat.
Meist wird Ralf Bönts Roman ja der Geschlechterdebatte zugeschrieben, aber er ist so viel mehr und stellt alles, was etwa Thomas Meinecke aus diesem Thema zu machen versteht in den Schatten: Eine Geschichte darüber, dass und wie Körper keine Grenzen haben, eine Abrechnung mit dem extremen Individualismus, gleichzeitig aber auch ein Buch über den Versuch des Widerstandes gegen die Macht der Anderen, den immer übergriffigeren Kapitalismus, das Scheitern. Ganz sicher ist es dabei keine Programmschrift.
Fantastisch schildert Bönt die anziehende Körperlichkeit einer ihm gegenüber sitzenden Korrespondentin oder von Neles Freundin Vivian. Immer ist das Abseitige auch im Normalen aufgehoben und dass es im Lauf des Buches immer schwieriger wird, beides zu unterscheiden, gehört zu seinen verblüffenden Leistungen. Ich habe es fast am Stück gelesen, das Buch ist spannend und dabei ruhig und mit beeindruckender Sicherheit im Detail geschrieben. Ich habe viel gelacht und war am Ende sehr berührt, denn Kindler verliert im Versuch, sich das Leben ganz anzueignen, buchstäblich alles. Aber hinter dieser großen Geschichte von Verlust und Ohnmacht steht natürlich eine Anrufung des Glücks, und zwar auch jedes kleinsten.
Karoline Babrowsky

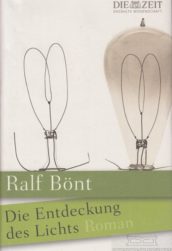

Die Entdeckung des Lichts
Dumont Verlag, Köln 2009
Die Zeit, Edition Erzählte Wissenschaft, Hamburg 2011
btb Taschenbuch, München 2011
Das Buch ist komponiert wie ein Bolero //
// Ralf Bönt im RBB-Interview mit Peter Claus.
Mehr Licht! //
// ZDF nachtstudio mit Volker Panzer.
Dieser Roman, zugleich spannende Geschichte und komplexes literarisches Kunstwerk, wird noch lange gelesen werden. Eine Prognose, so sicher, dass sie fast schon wissenschaftlich ist. //
// Daniel Kehlmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Deutschlandradio Büchermarkt anhören
“Die Entdeckung des Lichts ist ein detailreich erzählender Roman mit zum Glück
wenigen Extravaganzen: Die Sparsamkeit war
notwendig um die gewaltigen Bewegungen dieser Zeit verständlich zu machen. Dieser Anspruch ist auch wesentlich höher als bei anderen, z.B. Kehlmann und Gauss.”
Reinhart Kögerler

Die Besten 2009,
Klagenfurter Texte
Die 33. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Ausgezeichnet mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2009
Hrsg. v. Ijoma Mangold
Piper Verlag, München
Sehr lesenwert der Bericht eines Beobachters.
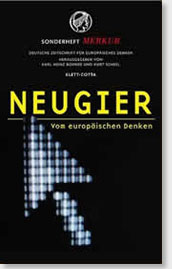
Celeritas
oder Die Entdeckung des Lichts
Zum Auszug aus dem Roman, der im Merkur,
Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken, Doppelheft 2008: Neugier, erschien.
Hg. Karl-Heinz Bohrer und Kurt Scheel, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
Schreibtischnotiz
Auf dem Buch, das hundertsechsundsechzig Jahre nach seinem Abschiedsbrief an Ada und dem einsamen Spaziergang im dunklen, verregneten London auf meinem Schreibtisch liegt, stützt Faraday im schwarzen Frack und weißen Hemd mit Stehkragen lässig den Oberkörper über seinen linken Ellbogen auf einen Tisch, halb lehnt er an ihm. Auf dem Tisch steht ein Kasten, aus dem sich eine Schnur schlängelt. Die Hände wie im Gebet gefaltet, geht der Blick vollkommen irdisch und zufrieden rechts am Betrachter vorbei auf ein halb hohes Ziel im Raum. Jung ist er auf diesem Bild, der Mund hat weibliche Züge.
Ich vergleiche ihn mit anderen Biografierten, die unsere Leben verändert haben. Washington und Bismarck sind auf ihren dicken Büchern beide in hohem Alter abgebildet. George Washington, der den Pocken getrotzt und in ungezählten Schlachten auf seinen Pferden gesessen hat, um aus indianischen, französischen und englischen Gewehren wie von geisterhafter Hand bestimmt keine einzige Kugel zu fangen, wird herrisch gezeigt, mit einem beinahe beleidigten Zug um den Mund. Dabei hat dieser Mann nach seinem Vierteljahrhundert des Morastes, der Bakterien und des Hungers mit Hilfe der Franzosen schließlich die Engländer besiegt und sich anschließend geweigert König von Amerika zu werden.
Bismarck wirkt bäuerlich. Das Bild stammt mit freundlicher Genehmigung aus Preußischem Kulturbesitz, aber Bismarcks Briefe sprühen vor Humor, Polemik und Einsicht.
Napoleon, der die Zeit für das große Element zwischen Masse und Kraft hielt, und der gar nicht erst erwachsen geworden ist, trägt einen Hut und seine roten Lippen in einer sicheren Ecke weiter links oben auf meinem Schreibtisch.
Einstein: Zum Glück prangt über dem Namen nicht das berühmte Bild mit den fahrigen langen Haaren und der ausgestreckten Zunge, das an seinem zweiundsiebzigsten Geburtstag aufgenommen worden ist. Dieses Foto, das der Meister aller Klassen an Freunde und Kollegen mit der Bemerkung verschickte, es gebe seine politischen Anschauungen wieder, wäre auch zu viel des Einfachen und Guten gewesen. Stattdessen hat er die Hand an einer im Mund endenden Pfeife und schickt seinen lässigen Blick wohin er gehört: an den Rand des Universums. Keine Andeutung seines albernen Wesens, davon, dass er Frauenheld und Vater verheimlichter Kinder war, oder dass sein Arzt ihm Stunden nach seinem Tod ohne Erlaubnis und in der blödsinnigen Hoffnung, etwas Außergewöhnliches zu sehen zu bekommen, das Gehirn aus dem Schädel trennte und in Würfel schnitt.
Ich blättere durch Faradays dünnen Band. Bei einer sich weit hinten befindenden einzelnen Seite aus Glanzpapier bleibe ich mit dem Daumen hängen: Auf diesem Bild ist auch er älter. Die Haare nun weiß, trägt er wieder Stehkragen, dazu einen Backenbart. Die Augen gehören noch immer dem neugierigen, angstlosen, glücklichen Jungen von früher, jetzt gebettet in ein Gesicht jener Müdigkeit, die seine klagenden und entschuldigenden Briefe füllt. Ich klappe das Buch zu.
Dass alles an einem Leben Zufall ist, kann man nicht akzeptieren. Wie soll man es erzählen? Vorne anzufangen ist wie das Anzählen eines Boxers im Ring, und vom Ende aus betrachtet legt sich Bedauern auf alles. Beides wäre falsch. Eine Zeit lang dachte ich, man müsse ein Ereignis finden, unter dessen Stern das Leben stand, das eine, alles entscheidende Ereignis und dann in Kreisen oder Spiralen oder vielstimmig und widersprüchlich oder ohne jede Ordnung um dieses Ereignis herum erzählen. Aber ich konnte mich kaum für ein Ereignis in Faradays Leben entscheiden und noch weniger gegen die anderen. Der Stern, unter dem ein Leben steht, leuchtet schließlich dauerhaft. Und ich begriff, dass man ein Leben von der Liebe her erzählen muss, die es ausgemacht hat. Sie ist es, die das Leben erzählt. Sie war es, der Faraday folgte.
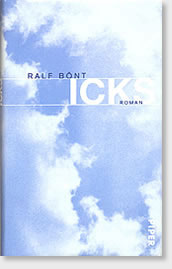

Icks
Piper Verlag, München 1999 und 2000
Neuauflage mit einem Nachwort des Autors
Dumont Buchverlag, Köln 2010
Vor zehn Jahren hat Icks seine provinzielle Heimatstadt verlassen und eine internationale Karriere als Physiker begonnen. Mit dem Fall der Berliner Mauer wird diese jäh beendet: Weil der Kalte Krieg vorbei sei, habe man die Konkurrenz aus dem Osten nicht mehr zu fürchten, und das große Forschungsprojekt wird vom US-Senat abgewickelt. Icks, in den sechziger Jahren geboren, erlebt den ersten Einbruch der Geschichte in seine Biographie als plötzliche Arbeitslosigkeit. Als mittlerweile junger Vater und desillusioniert reist er zum ersten Mal seit zehn Jahren zurück zu seinen Eltern. Schon am Bahnhof konfrontiert ihn der Ort mit seiner Jugend, es beginnt eine Rückreise in die vergangenen dreißig Jahre. Adenauer, Hendrix und Dr. Oetker sind Stationen auf der Erkenntnis, dass seine Geschichte eine deutsche ist, und das Schweigen im Haus seiner Eltern noch immer vom Schock des Krieges stammt, den sie als Kinder erlebt haben. Der Besuch endet im Eklat. Schließlich verschwindet Icks in der Unmöglichkeit, zwischen Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit einen Platz zu finden.
Ralf Bönt hat eine Figur geschaffen, die zeigt, dass der Wunsch nach einem Schlussstrich unter das 20. Jahrhundert und der Wunsch nach einer Konservierung der Geschichte im Ursprung identisch sind. Die Quintessenz überrascht weniger: keine der beiden Haltungen ist lebbar. ‘Icks’ ist daher die große Parabel auf das unaufgelöste Selbstverständnis der Deutschen am definitiven Ende der Nachkriegszeit.
German Book Office, New York 2000
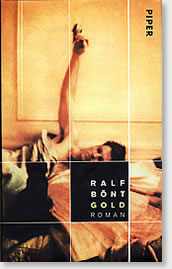

Gold
Piper Verlag, München 2000
Auszug aus dem Roman
Ingeborg Bachmann Wettbewerb
herausgegeben von
Iso Camartin und Thomas Tebbe
Piper Verlag, 1998
“Gold” überzeugt durch seinen ganz eigenständigen Sound und lässt den 37jährigen Ralf Bönt zu einem Hoffnungsträger der jungen deutschen Literatur werden.
“Wir befinden uns am Ende des Jahrhunderts, in der Hauptstadt” und “irgendwie fühlte man, dass Geschichte in der Luft lag, schwanger schien alles” – in seinem zweiten Roman entwirft Ralf Bönt ein schwankendes Kaleidoskop des von grandiosen Medienmythen und desorientierten Menschen bevölkerten Berlin. Seine nur vordergründig so abgeklärten Protagonisten Anna, Lotte, Hans und Dorado stecken in einem verzwickten Wechselspiel aus Fehl- und Seitensprüngen, aus Liebe, Eifersucht und Traumgespinsten: “In ihren Schädeln Tumult, Gott kaum, und in den Herzen strömt beißendes Blut.” Ebenso wie diese vier letztlich nur ein Rad im gesellschaftlichen Getriebe sind, so sind sie die willkürlich zu manipulierenden und zynisch zu kommentierenden Marionetten eines anmaßenden “Wir”-Erzählers. Dieser zieht diabolisch an den verwickelten Fäden, lässt die Geschichte vor- und zurücklaufen, variiert und kolportiert. Seine Sprache ist die eines mediengesteuerten öffentlichen Bewusstseins und pendelt zwischen kapitalistischen Heilsversprechen, autonomer Subversion und jauchzendem TV-Quiz.
Ralf Bönt schreibt auf der Höhe einer Zeit, in der Gefühle, Hoffnungen, Sehnsüchte und ein permanentes Mediengemurmel zu einem höchst widersprüchlichen Konglomerat zusammenschießen und sich nicht mehr in “endgültige Wahrheiten” auflösen lassen. Er operiert dabei mit einem sehr avancierten Erzählmuster und einer urbanen Poetik, die ebenso zärtlich wie obszön und von surrealen Verfremdungen durchzogen ist. “Gold” überzeugt durch seinen ganz eigenständigen Sound und lässt den 37jährigen Ralf Bönt zu einem Hoffnungsträger der jungen deutschen Literatur werden.
Karsten Herrmann, Culturmag

Gold
Auszug aus dem Roman
Heft 2 / April 1999: Neue Zeiten! Und die Literatur?
Akzente der deutschen Gegenwartsliteratur,
herausgegeben von Norbert Niemann und Wolfgang Matz,
C. Hanser Verlag
Mit Beiträgen von:
Ralf Bönt / Norbert Niemann / Ulrike Draesner /
Georg M. Oswald / Arno Geiger / Albert Ostermeier /
Heiko Michael Hartmann / Kathrin Röggla /
Annegret Held / Birgit Vanderbeke
“Der kulturkritische Jammerton, an dessen Berechtigung nicht der geringste Zweifel möglich ist, hat eigentlich nur einen Fehler. Er nimmt der Literatur die Möglichkeit, sich wirklich auf die Verhältnisse einzulassen. Es ist eine Sache, über die Populärkultur und alles, was mit ihr zusammenhängt, zu klagen: vor allem über den fast vollständigen Bedeutungsverlust von Literatur im öffentlichen Raum.
Es ist eine andere Sache, wenn Autoren versuchen, sich ihr Bild von einer Welt zu machen, die ihrerseits häufig nur noch aus bunten Bildern, Lärm, Gerede zu bestehen scheint. Denn eine Literatur, die den Begriff Gegenwartsliteratur ernst nimmt, müßte doch zumindest den Versuch unternehmen, die Gegenwart so wahrzunehmen, wie sie ist: Geprägt von elektronischen und gedruckten Bildern, von optischer Allgegenwart der Katastrophen und Kriege, von akustischer Dauerberieselung.”
Norbert Niemann / Wolfgang Matz
Nichts ist frustrierender als Pornographie
Ralf Bönt über seine Romane “Icks” und “Gold” und sein Verhältnis zu Metropolen
Von Julia Schöll
literaturkritik.de » Nr. 12, Dezember 2000 (2. Jahrgang) » Autorengespräch
Als Autor erreichte Ralf Bönt erstmals 1998 ein größeres Publikum, als er auf dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb für die Präsentation von Auszügen aus seinem Roman “Gold” das 3sat-Stipendium erhielt. “Gold” erschien als Bönts zweiter Roman im Frühjahr 2000 im Piper Verlag. Der Roman berichtet neben einer Beziehungskiste (mit mehr als drei Ecken) von Politik, Macht und Geld im goldenen Zeitalter der Berliner Republik. Während die Figuren im Vordergrund ihre Abhängigkeitsbeziehungen pflegen, kommentiert im Hintergrund die Stimme eines kollektiven “Wir” die Handlung sowie die Geschehnisse in “D-Land”, wobei sich verschiedene Stimmen mischen und übereinanderlegen. “Die Welt” nannte den Roman ein “gnadenlos präzise” ausgetüfteltes “Sprachpuzzle” (vgl. auch literaturkritik.de 2000-06-51.html).
Bereits letztes Jahr erschien, ebenfalls bei Piper, Bönts Roman “Icks”, der ein erhebliches Presseecho auslöste. “Icks” ist der Monolog des gleichnamigen Helden, der im Flugzeug auf dem Weg nach New York seinem Sitznachbarn im Verlaufe unzähliger Gläser Whisky seine Lebensgeschichte erzählt – oder doch so etwas wie seine Lebensgeschichte. Aufgewachsen in der Öde der 70er und 80er Jahre in der “Leinenweberstadt” (unschwer als Bielefeld zu identifizieren, wo Bönt aufwuchs), erzählt Icks von seiner Rückkehr in die Heimatstadt und seinem ersten Besuch bei den Eltern seit zehn Jahren. Während er mit den Schatten der Vergangenheit und seinem eigenen Versagen kämpft, verpasst er in seiner neuen Heimat, Berlin, das Leben (sein kleiner Sohn lernt dort gerade laufen). Icks scheitert nicht nur an einer verpfuschten wissenschaftlichen Karriere, sondern auch an der Spießigkeit seines Elternhauses – die er erkennt, aber nicht überwindet – und seiner Unfähigkeit, anderen wirklich nahe zu kommen.
Julia Schöll traf Ralf Bönt, der heute in Berlin lebt, im herbstlichen New York, wo er als Gewinner des Stipendiums des German Book Office New York vier Wochen im Ledig-Haus in Upstate New York zu Gast war und anschließend auf Lesereise quer durch die Vereinigten Staaten ging.
Julia Schöll.: Gestern in der Lesung an der New York University sagten Sie, die Hauptperson Ihres Romans “Icks” stehe für x, die mathematische Unbekannte, während Icks von den meisten Rezensenten bisher mit Couplands “Generation X” assoziiert wurde. Hat er denn mit Coupland etwas zu tun?
Ralf Bönt: Ich habe Coupland damals gelesen, fand das aber nicht besonders toll, wobei ich immer zuerst auf Sprache achte. Hinzu kam, dass mir die Situation des Aussteigers nicht besonders nah war. Ich persönlich fühle mich überhaupt nicht dieser Generation X zugehörig. Mein Held Icks ist es vielleicht ein bisschen. Meine Assoziation beim Schreiben war aber wirklich die Variable x.
SCHÖLL: Und in welcher Hinsicht ist Icks eine Variable?
BÖNT: x ist ein leeres Symbol, das erst eine Bedeutung bekommt. Es ist eine Metapher für Icks, der feststellt, dass er, anders als er lange glaubte, nicht ein perfekter Individualist sein kann, sondern nur dadurch, dass er Teil einer Gesellschaft ist, zu einer Bedeutung kommt. Diese Bedeutung erlangt er nicht nur durch den soziologischen, sondern auch durch den historischen Kontext, nämlich den Mauerfall. Er ist quasi das Gegenbeispiel zu dem, was man mit dem Mauerfall assoziiert: Die Ossis kriegen Kohle. Hier wird der Wessi arbeitslos.
SCHÖLL: Ich muss gestehen, dass mich Icks als Person ziemlich genervt hat. Man kann die Situation so gut nachvollziehen, wie er auf seinen Nachbarn im Flugzeug einredet, der ihm nicht entkommen kann. Tatsächlich ist Icks fast den ganzen Roman über mit Jammern beschäftigt: Das Umfeld ist schuld an seiner Misere, die Eltern, der Mauerfall, sogar Auschwitz. Und am Ende? Gelingt es Icks schließlich, sich von all dem zu befreien? Hat er jemals die Chance, erwachsen zu werden? Oder anders gefragt: Wird die Leerstelle x jemals gefüllt?
BÖNT: Das ist im Buch offen gelassen, aber es ist bestimmt nicht so, dass alle anderen schuld sind. Denn nachdem er bei seinen Eltern war und zurückfährt, fängt er ja an, alles was er vorher gegen das Milieu und seine Eltern vorgebracht hat, gegen sich selbst zu wenden, den Hass zum Beispiel. Er behauptet, genauso zu hassen wie seine Eltern, und, was am schlimmsten ist, kalt zu hassen. Wenn es wenigstens ein heißer Hass wäre. Das bekommt er von seiner Frau im letzten Telefonat wieder zurückinjiziert, sodass er am Ende tatsächlich allein ist. Weder ist er zurückgefahren nach Berlin, um dabei zu sein, als sein Kind Laufen lernt – was ja durchaus ein touching moment ist -, noch hat er irgendwie versucht, Kontakt herzustellen zu diesen Personen. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, zu sagen, dass dies eine Geschichte der Selbstzerstörung ist. Sie läuft von Anfang an darauf hinaus: Nachdem Icks alles totgetrampelt hat, was um ihn herum war, und seine Aggression mitnichten geringer geworden ist dadurch, bleibt nur noch er selbst.
Das ist vielleicht ein kompliziertes Bild, aber man kann sagen, dass die Erfahrung, in Geschichte eingebettet zu sein, für ihn so etwas wird wie ein Autoimmundesaster. Die Reise in seine Heimat infiziert ihn mit Wissen über sich und sein Land. Dieses Wissen kann er nicht aushalten, er will es zerstören, um zu überleben. Da es aber in ihm selbst, ja er selbst ist, wird die Abwehr zu einer Autoagression. Er richtet sich gegen sich selbst.
SCHÖLL: Man könnte am Ende ja auch annehmen, dass alles gut wird: Er geht zurück nach Berlin, seine Ehe läuft gut, der Job am Theater wird was…
BÖNT: Ja, und er baut das Haus! Der Hausbau ist sehr wichtig.
SCHÖLL: Und wird doch wie seine Eltern.
BÖNT: Ja, dann lädt er seine Eltern zum Kaffee ein.
SCHÖLL: Noch eine Frage zum leidigen Problem der Autobiographie. Sie haben sich immer dagegen gewehrt, dass “Icks” autobiographisch gelesen wird…
BÖNT: Ich habe jetzt aufgehört, mich dagegen zu wehren. Mittlerweile ist mir das vollkommen wurscht. Wenn jemand meinen will, es sei autobiographisch, dann soll er das meinen. Diese Frage finde ich vollkommen uninteressant.
SCHÖLL: Mir geht es auch nicht darum, herauszufinden, ob der Roman autobiographisch ist. Ich finde vielmehr interessant, dass Sie in einem Interview zu der Frage nach dem autobiographischen Gehalt sagten, es schmeichle Ihnen, dass der Roman so gedeutet würde. Inwiefern finden Sie das schmeichelhaft?
BÖNT: Weil es offenbar authentisch klingt. Es ist übrigens nicht verwunderlich, wenn Icks Ihnen auf die Nerven gegangen ist. Die Sache ist durchaus nicht frei von gender-troubles. Es wurde viel darüber geredet, ob “Icks” ein Männerbuch ist.
Aber zurück zu Ihrer Frage. Icks ist im wesentlichen eine Person, die behauptet, keine Erfahrungen gemacht zu haben, keine Biographie zu haben. Sie sagten, alles und alle seien schuld: Die Eltern sind schuld, die Mauer ist schuld, Clinton ist schuld. Wenn man es zuspitzen will, dann sagt er, sein Problem sei, dass er nicht in Auschwitz war. Er erzählt, dass er festgestellt hat, dass er gar nicht weiss, wo Auschwitz liegt. Er hat es im Atlas dann in Polen gefunden und festgestellt, er war mal in der Nähe, hat aber gar nicht gewußt, dass es dort ist. Auschwitz ist irgendwie ein Gravitationszentrum für das Milieu, in dem er lebt, in dem er aufgewachsen ist. Auschwitz ist eine der deutschen Wirklichkeiten. Es ist die Grabplatte: Da drunter liegt alles, beziehungsweise, da drauf steht alles. Und ganz überspitzt formuliert kann man sagen, sein Problem ist, nicht dort gewesen zu sein.
Das korrespondiert auch mit dem Initialtext, der von Imre Kertész ist: “Kaddisch für ein nicht geborenes Kind”. In diesem Buch monologisiert ein Protagonist, der in Auschwitz war. Er kann danach nicht mehr leben. Man kann also in keinem Fall leben und will doch. Das ist die Natur der deutschen Geschichte.
SCHÖLL: In Ihrem aktuellen Roman “Gold” geht es ja wieder um sehr deutsche Befindlichkeiten. Es gibt in dem Roman ein erzählendes “Wir”, das weit über dem Geschehen steht und auf die agierenden ‘Helden’ herabschaut. “Wir” kommentiert das Geschehen und scheint alles im Griff zu haben. Wer ist “Wir”?
BÖNT: Wir sind “Wir”.
SCHÖLL: Wir sind “Wir”?
BÖNT: “Wir” spricht das kanonisierte Reden und Denken aus. Im “Wir” sind gesellschaftliche Gruppen repräsentiert, die sich in ihren Denkbewegungen und Reaktionsmustern sehr einig sind. Im Verlauf des Buches trifft man auf Stimmen, die man vielleicht nicht erwartet hätte: auf das Trivial-Bürgerliche, das vereinigte Durchschnittsbürgertum, den Bankangestellten… und im ersten Kapitel gibt es nur ganz wenige Tritte in andere Sektoren. Aber im zweiten Kapitel wird das dann weiter aufgefächert, man trifft da auf Altgrüne, Dummfeministinnen… (er lacht) – allerhand pöbelndes Volk sozusagen. Und die haben alle etwas gemeinsam. Es ist immer die gleiche Art und Weise, wie sie gegen die vermeintlichen ‘Helden’ vorgehen.
Ich finde das nicht so schlimm, wenn das nicht jeder für sich so auflöst. Aber das “Wir” ist eigentlich die Hauptperson. Erzähler und Erzählte sind vertauscht.
SCHÖLL: Traditionell ist der Erzähler doch der, der danebensitzt und die Sache kommentiert.
BÖNT: Ich hasse den zentralen Erzähler, weil ich glaube, dass das eine objektive Zuschreibung ist. Ich glaube, dass der Erzähler sich immer irgendwie positionieren muss, und ich denke auch, dass der Erzähler erkennbar sein sollte. Das ist zumindest in der Arbeitsphase, in der ich die beiden Romane geschrieben habe, so gewesen. Und es ist kein Wunder, wenn die sich auf der Bühne dann ansammeln.
SCHÖLL: Es sind also viele Stimmen?
BÖNT:… und kein Zentrum.
SCHÖLL: Wie steht es eigentlich mit dieser kryptischen Figur des “Vorstands”, der am Ende sogar von der eigenen Tochter ermordet wird. Er steht für deutsche Macht, auch Wirtschaftsmacht…
BÖNT: Und er verliest die politischen Reden zum Aschermittwoch und zum Heiligen Abend, die übrigens nicht, wie manche meinten, die Kohlsche Rede ist, sondern, wenn man es genauer anguckt, eine amerikanische Rede ist, eine Kongreßrede.
SCHÖLL: Und seine Tochter?
BÖNT: Die Tochter ist das einzige Bindeglied zwischen diesen beiden Welten. Sie versucht, sozusagen, zwischen dem Öffentlichen, Gemeinen und den vier Helden eine Verbindung herzustellen. Und das gelingt ihr nicht. Sie will das Maß einerseits vollmachen und es andrerseits halten, das Maß halten, indem sie den Vater tötet. Was natürlich nichts nützt; es kommt einfach ein Nachfolger.
SCHÖLL: Man hat das Gefühl, bei diesem Mord geht es gar nicht um den Vater, sondern sie will sich mit dem Vatermord in diese andere Gesellschaft ‘einkaufen’. Sie versucht ja in die Geschichte reinzukommen.
BÖNT: Ja, so kann sie ihre Einsamkeit offenbar gegenüber den anderen aufheben.
SCHÖLL: Oder zumindest hat sie diese Illusion.
BÖNT: Das ist doch schon mal ganz schön, weil das ja implizieren würde, dass die anderen lieben und nicht nur Spielfiguren sind, die keinen Charakter haben. Wenn man nur die wörtliche Rede nimmt, wenn man allen “Wir”-Kommentar wegnimmt und sich die wörtliche Rede genau angucken würde, dann würde man merken, dass die Figuren absolute Charaktere sind.
SCHÖLL: Ich habe die Figuren durchaus als Charaktere verstanden. Jeder hat eine Geschichte, sie haben Katzen, sie haben Verhältnisse, sie scheitern… Ich finde schon, dass sie Charaktere sind. Was mich dann allerdings irritiert hat, war eine Bemerkung von Ihnen, dass Sie mit “Gold” einen Porno geschrieben hätten. Ein Porno zeichnet sich doch aber gerade dadurch aus, dass er keine Charaktere, sondern Typen agieren läßt.
BÖNT: Was ist denn eine Pornographie? Darauf müßte man sich vielleicht erst einigen. Pornographie hat doch immer damit zu tun, dass man versucht, eine Sehnsucht zu stillen, indem man auf einem verkürzten Landeplatz landet mit seinem Fallschirm. Deswegen ist der Porno auch so langweilig. Der Porno ist gar nicht zum Aushalten. Dieser – allerdings verständliche – Wunsch, diese verkürzten Anflüge auf die Landeplätze sind in der “Wir”-Stimme dauernd gegeben. Und weil diese verkürzten Landeplätze angeflogen werden, landet diese “Wir”-Stimme auch grundsätzlich im Ressentiment, aus Frustration selbstverständlich. Nichts ist frustrierender als Pornographie.
Dieser Roman ist in dem Sinne eine Pornographie, dass der Erzähler permanent versucht, die Figuren zu verkürzen auf etwas, was sie nicht sind. Also ist er nicht eigentlich eine Pornographie, und ich habe das nur der Zeitung gesagt, weil es so schön klingt und Sie mich danach fragen würden.
SCHÖLL: Aber die Figuren versuchen doch auch diesen Kurzanflug: Anna zum Beispiel versucht das große Abenteuer zu erleben, indem sie sich einen Stricher nimmt. Das ist doch auch eine verkürzte Landebahn…
BÖNT: Das ist für sie aber doch ein weiter Weg: Erst muss sie die Tat gestehen, um sie dann tatsächlich umsetzen zu können. Sie muss quasi schon alle Konsequenzen in Kauf nehmen, um sich mit Energie vollzupumpen, es dann doch noch zu machen. Sie gesteht nur aus Wut über sich selbst, weil sie es nicht fertigbringt, es zu tun.
SCHÖLL: Warum will sie es denn überhaupt tun?
BÖNT: Nun, es gibt eben doch zwei, drei Frauen, die das gerne mal machen würden. Das hat was mit der Zeit zu tun, in der wir leben – diesmal nicht mit gender-trouble -, weil Kaufen doch durchaus etwas Erotisches hat.
SCHÖLL: Als Leserin habe ich gar keine Chance, an die Gestalten heranzukommen, ihr Handeln zu verstehen. Die Bewertung des Geschehens durch “Wir” schiebt sich immer dazwischen.
BÖNT: Man muss den Figuren zuhören können. Die Aufgabe ist sicherlich nicht leicht. Es ist schon der autarke Leser – den es ja nicht gibt – gefragt. Selbstverständlich ging es mir darum, genau dieses Spielchen zu spielen, genau das Gegenteil vom so genannten realistischen Erzählen. Wie ich sagte: Erzähler und Erzähltes sind miteinander vertauscht, und die Hauptperson ist keine der genannten. Ob man eine Chance hat, an diese Figuren ranzukommen, ist eine Frage der Fähigkeit, auf die wörtliche Rede tatsächlich einzugehen. Auch eine Frage der Fähigkeit, die Geschichten, die ja mehrfach erzählt werden, zu sieben und wieder zusammenzubauen.
SCHÖLL: In Ihren Büchern geht es immer auch um die Stadt New York: Icks ist auf dem Weg nach New York, als er seinem Nachbarn im Flugzeug seine Lebensgeschichte erzählt. Und in “Gold” ist New York eine Art Gegenwelt zu der deutschen Realität.
BÖNT: New York ist der Ort, zu dem der Berlin-Tourist unterwegs ist. Der – vom Nürnberger Stadtrand aus betrachtet – das alles ganz toll findet. Es ist der nächste Ort nach Berlin, sobald man weiß, welche Bars gerade angesagt sind, und an den Punkt kommt, wo man merkt, dass man sich in Berlin doch nicht richtig niederlassen kann und nicht richtig zuhause ist. Das dauert, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre. Von da aus gibt es eigentlich nur noch einen Fluchtort, als Küste für alle Schwimmer ohne Schwimmweste.
SCHÖLL: Und was kommt nach New York?
BÖNT: Dann kann man sich entweder in New York festsetzen – was nicht jeder schafft – oder man geht wieder zurück an den Stadtrand von Nürnberg.
SCHÖLL: Vielen Dank für das Gespräch.

